CfP: Mehr als Tell und Heidi. Deutsch-Schweizerische Filmbeziehungen
XXI. cinefest und der 37. Internationale Filmhistorische Kongress 20.-23. November 2024 – Deadline: 1. Juni 2024
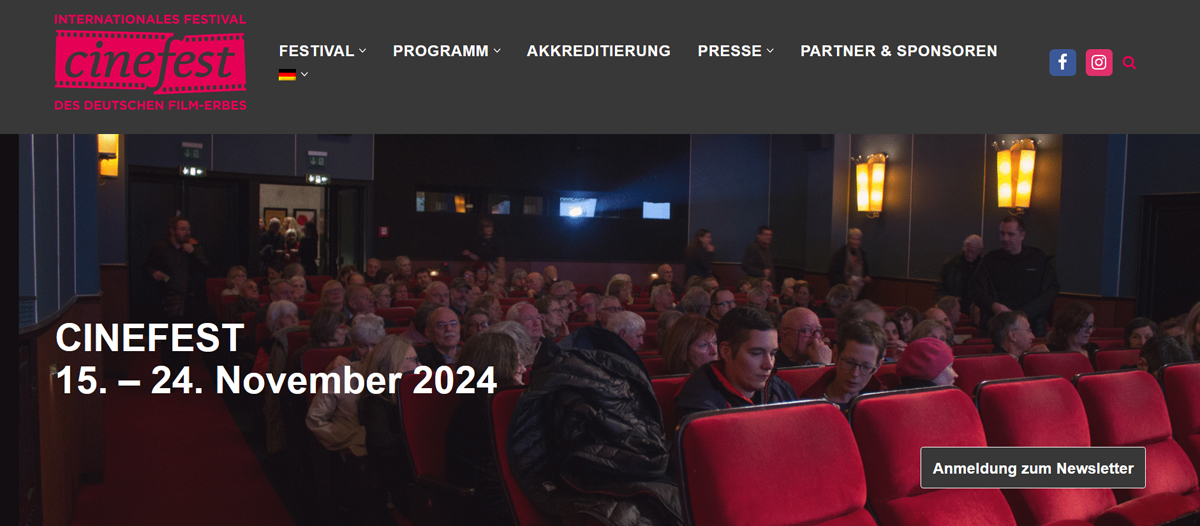
Website: Cinefest 2024
Zahlreiche, aus der Schullektüre bekannte Literaturklassiker lieferten über die Jahrzehnte in verschiedenen Ländern immer wieder die Vorlage für Adaptationen, z.B. Gottfried Kellers „Kleider machen Leute“ (1921, Hans Steinhoff; 1941, Helmut Käutner; 1963, Paul Verhoeven) oder „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ (1941, Hans Trommer; 1967, Willi Schmidt; 1983, Siegfried Kühn). Bereits früh gab es im Stummfilm Co-Produktionen über die Grenzen hinweg, so „Dcery Eviny / Evas Töchter / Anny … Fille D’ève“ (1927/28, CS/DE/CH) mit dem europaweit populären tschechischen Duo Karel Lamač und Anny Ondra.
Die Einführung des Tonfilms zwang in den frühen 1930er Jahren die Produzenten wegen der erhöhten Kosten verstärkt zu internationalen Co-Produktionen, um sich so durch Zusammenfassung der verschiedenen deutschsprachigen Märkte ein größeres Absatzgebiet zu erschließen.
Als die Produktion des Brecht-Films „Kuhle Wampe“ 1931/32 in Deutschland in finanzielle Probleme geriet, stellte der aus Polen stammende Lazar Wechsler, der in Zürich die Praesens-Film gegründet hatte, finanziell die Fertigstellung sicher. Gleichzeitig – und am anderen Ende des politischen Spektrums – produzierte er „Tannenberg. Ein dokumentarischer Film über die Schlacht von Tannenberg“, der in der Schweiz jedoch nicht verliehen wurde. Wechslers Firma Praesens-Film feiert 2024 ihr 100-jähriges Jubiläum und wird mit zahlreichen ihrer für die eidgenössische Filmgeschichte bedeutenden Filme im Programm vertreten sein.
Eine direkte Aktivität von (jüdischen) Emigranten gab es nicht, da ihnen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit untersagt war. Allerdings kamen zahlreiche Filmschaffende aus Deutschland und setzten hier ihre Karriere am Theater (Schauspielhaus Zürich) fort und konnten dadurch auch im Film erfolgreich sein. Die gleichzeitig realen Abgrenzungen gegenüber Geflüchteten, antisemitische und rechtsradikale Tendenzen in politischen Kreisen der Schweiz wie auch die Versuche, sich diesen entgegenzustellen, wurden im Film erst in den Jahren nach dem Krieg durch eine jüngere Generation der Filmmacher behandelt.
Nach dem Krieg sind – oft in deutsch-schweizerischen Co-Produktionen – namhafte Schweizer wie Bernhard Wicki, Maximilian Schell, Paul Hubschmid und Liselotte Pulver vorwiegend in Deutschland tätig, so in der Hamburger Produktion „Die Zürcher Verlobung“ (1956/57, Helmut Käutner). Schriftsteller wie Friedrich Dürrenmatt, Lukas Hartmann und Max Frisch liefern Vorlagen für oft internationale Verfilmungen.
Parallel zum Jungen deutschen Film und oft auch mit personeller Vermischung und – durch die Beteiligung deutscher und schweizerischer TV-Anstalten – entwickelt sich in den 1960/70er Jahren auch in der West-Schweiz eine „Neue Welle“.
Alle diese Entwicklungen und die vielfältigen bi- und internationalen Verflechtungen sind Thema beim XXI. cinefest und dem 37. Internationalen Filmhistorischen Kongress.
Mögliche Themenkomplexe beim Kongress
– Co-Produktionen der 1930er Jahre
– Produktionsfirmen (Terra-Film, Praesens-Film, Gloriafilm …)
– GLV – Geistige Landesverteidigung und der Film
– Präsenz deutscher Filme in der Schweiz 1933-1945
– Rolle der Exilierten im Schweizer Film
– Aufarbeitung der Rolle der Schweiz gegenüber Nazi-Deutschland
– Schweizer Co-Produktionen mit der DDR
– Location Schweiz
– Klassikerverfilmungen (Gottfried Keller, Robert Walser, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Martin Suter …)
– Blick auf das jeweils andere Land im Film
– Personalaustausch zwischen den Ländern
– Co-Produktionen und Austausch mit Drittländern (u.a. Mitteleuropa)
Weitere Themenvorschläge sind willkommen.
Die Vorträge sind auf ca. 20 Minuten angesetzt und werden anschließend im Plenum diskutiert. Die Konferenzsprachen sind Deutsch oder Englisch (es gibt keine Live-Übersetzung). Der Kongress findet voraussichtlich in hybrider Form statt (Präsenz und Videostream). Vortragende erhalten den Festival-Katalog sowie eine Kongress-Akkreditierung, die auch zum Besuch der Kinoveranstaltungen vom 20. bis 24. November 2024 berechtigt.
Auswärtige Vortragende können in der Regel mit einem Reisekostenzuschuss unterstützt werden.
Im Anschluss an den Kongress werden die überarbeiteten Vorträge in einem Buch veröffentlicht, das im Herbst 2025 bei edition text+kritk erscheint. Die Vortragenden stimmen mit der Teilnahme am Kongress einer Veröffentlichung zu. (Abgabetermin der Texte 15.01.2025.)
Gerne können Vorschläge für Vorträge in Form eines Abstracts (ca. 1500 Zeichen) inkl. einer Kurzbiografie bis zum 1. Juni 2024 an kongress@cinegraph.de geschickt werden.
In Vorbereitung auf Kongress und Festival findet vom 24. – 26. April 2024 ein internes Sichtungskolloquium im Bundesarchiv, Standort Lichterfelde (Finckensteinallee 63) statt. Bei Interesse an einer Teilnahme schreiben Sie bitte an kongress@cinegraph.de. Für die Teilnahme an der Sichtung wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 20 Euro erhoben.
XXI. cinefest – Internationales Festival des deutschen Film-Erbes und der 37. Internationale Filmhistorische Kongress werden veranstaltet von CineGraph Hamburg und dem Bundesarchiv in Kooperation mit zahlreichen nationalen und internationalen Institutionen.
Kontakt
Erika Wottrich, CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung e. V.
Schillerstr. 43,22767 Hamburg
Tel.: +49-(0)40-352194, Fax: +49-(0)40-345864
Mail: kongress@cinegraph.de

