Rezension: „Corona und die journalistische Bildkommunikation. Praktiken und Diskurse des Visuellen”
ein Sammelband herausgegeben von Felix Koltermann
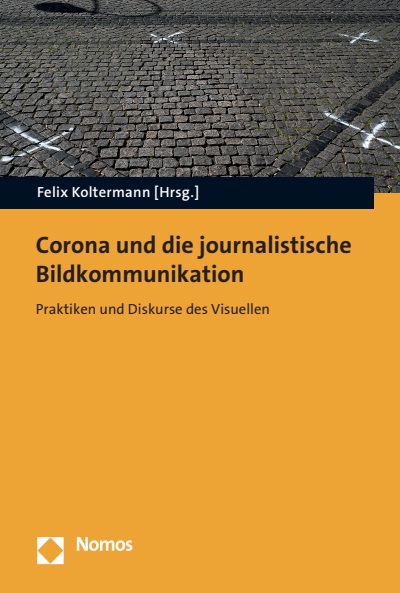
Cover: Felix Koltermann (Hrsg.), Corona und die journalistische Bildkommunikation. Praktiken und Diskurse des Visuellen, Nomos, 2021 ©
Selten ist das Thema eines Sammelbandes so aktuell wie das des vorliegenden: „Corona und die journalistische Bildkommunikation“, herausgegeben von dem Kommunikationswissenschaftler und Journalisten Felix Koltermann. Dass es sich dabei nur um eine Momentaufnahme handeln kann, ist kaum nötig zu erwähnen. Ein absehbares Ende der Pandemie war zum Redaktionsschluss des Bandes im Mai 2021 ebenso wenig in Sicht wie zur Veröffentlichung dieser Rezension. Folgerichtig beabsichtigen die Autor:innen nicht, die langfristigen Folgen der Pandemie auf den Bildjournalismus zu prognostizieren; vielmehr soll hier eine Art Zwischenfazit nach rund einem Jahr Pandemie gezogen werden. Die einzelnen Beiträge betrachten, wie die Coronakrise die Arbeit von Bildredakteur:innen, Foto- und Datenjournalist:innen bis zu diesem Zeitpunkt eingeschränkt und verändert sowie neue Diskurse geschaffen hat.
Die Autor:innen des Sammelbandes aus dem Kollegium des Hannoveraner Studiengangs „Fotojournalismus und Dokumentarfotografie“ verlassen sich dabei nicht nur auf die systematisch erhobenen Ergebnisse ihrer Studien, sondern ziehen ganz bewusst einzelne Stimmen aus der Berufspraxis heran, um die dargelegten Erkenntnisse mit Erfahrungen zu ergänzen und einzuordnen. Die Grundpfeiler und den roten Faden zugleich bilden drei wissenschaftliche Aufsätze, die von je einem Interview mit einem freien Fotografen und einem visuellen Datenjournalisten flankiert und von einem abschließenden Essay abgerundet werden. Diese Kombination aus quantitativen und qualitativen Erkenntnissen ermöglicht einen breiten Eindruck von den gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen des Bildjournalismus.
Im ersten Beitrag des Sammelbandes schildert Lars Bauernschmitt „Die Entwicklung des Bildermarktes in Deutschland unter den Bedingungen der Coronapandemie“ (S. 11-35) und stellt die Ergebnisse einer Erhebung unter Bildagenturen und Fotograf:innen zu den Auswirkungen der Pandemie auf ihre berufliche Situation vor. Für eine realistische Einordnung skizziert der Autor auch die wirtschaftliche Ausgangslage der Akteur:innen unmittelbar vor Beginn der Pandemie. Zunächst scheinen die Ergebnisse der Studie nicht sonderlich zu überraschen, da sie das in Zahlen fassen, was empirisch vermutet werden kann: „[…] dass die Coronapandemie erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit der meisten befragten Fotograf:innen hatte“ (S. 21), wie wirtschaftliche Einbußen durch rückläufige Nachfrage, verringerte Budgets, Absagen oder Verzögerungen. Widersprüchlich dazu erscheint die geringe Inanspruchnahme der staatlichen Coronahilfen, die in der Studie ebenfalls konstatiert wird. Viele der Befragten betrachteten diese staatlichen Hilfen als „bürokratisch, unangemessen oder nicht praktikabel“ (S. 23).
Bauernschmitt schildert, wie sich die Lage (vornehmlich) freier Fotograf:innen nicht erst beginnend mit der Pandemie verschlechtert habe. Stattdessen sei die Tendenz seit Jahren zu beobachten, wie sich die Schere zwischen der steigenden Bedeutung und Anzahl von Bildern auf der einen Seite und den sinkenden Umsätzen kleinerer Bildagenturen und freier Fotograf:innen auf der anderen Seite immer weiter öffne. Durch die Pandemie sei dieses Problem regelrecht katalysiert worden. Hier mahnt Bauernschmitt mit Sorge die Folgen dieser Entwicklung für den Journalismus an, der damit langfristig an Vielfalt und nicht zuletzt Unabhängigkeit verlieren könnte.
Das anschließende Gespräch zwischen dem Herausgeber des Sammelbandes Felix Koltermann und dem Berliner Fotojournalisten Christian Mang (S. 37-53) knüpft unmittelbar an die im vorangegangenen Beitrag präsentierte Studie an und ergänzt die Ergebnisse um einen persönlichen Erfahrungsbericht aus der Praxis eines freien Berufsfotografen. Besonders interessant sind Mangs Einblicke in die arbeitspraktischen Auswirkungen der Pandemie: Er berichtet von zugewiesenen Plätzen bei Presseterminen, welche die Perspektive der Fotograf:innen festlegten, von der Notwendigkeit größerer Distanz zu den zu fotografierenden Personen oder das Tragen von Masken, wodurch die Emotionen kaum bis gar nicht mehr sichtbar seien – Umstände, die sich nicht nur auf das Arbeiten, sondern auf die Ergebnisse der Arbeit unmittelbar auswirkten. Wünschenswert wäre hier besonders die Erklärung von im Gespräch unter Fachkollegen selbstverständlich genutzten Fachbegriffen wie zum Beispiel „mfm-Liste“ (S. 37) oder „Anstrichhonorare“ (S. 38) gewesen.

Kreuzimpfung mit AstraZeneca und BioNTech/Pfizer, 19. Juli 2021, Foto: Dirk Vorderstraße, Quelle: Flickr
Darüber hinaus sind Mangs Einschätzungen und Erfahrungen im Zusammenhang mit Coronaleugner:innen, der radikalisierten Protestkultur und allgemeinen Pressefeindlichkeit besonders eindrücklich. Nach Mangs Einschätzung fehlten in Deutschland Bilder, welche die Emotionen und Zustände in der Pandemie ausdrücken können – wie zum Beispiel die Fotografien der ausgehobenen Gräberfelder in New York. In der deutschen Bildberichterstattung sei stattdessen mehr mit Symbolbildern gearbeitet worden, so Mang, die aber „[…] in sich selbst nichts über die aktuelle Situation oder den Verlauf der Pandemie erzählen“ (S. 53). In Deutschland mangele es an aussagekräftigen Fotografien, die als „ikonische Bilder der Pandemie im kollektiven Gedächtnis bleiben“ (S. 53).
An diese Leerstelle schließt Karen Fromms Aufsatz „Leeres Zentrum – periphere Bilder. Die visuelle Berichterstattung zur Coronapandemie“ (S. 55-80) an. Sie geht der Frage nach, wie eine gesellschaftliche Krise dieser Größenordnung adäquat visualisiert werden könne – oder eindrücklicher in ihren Worten: „Wie kann man Leid und Tod vermitteln?“ (S. 59). Fromm entfaltet komplexe Problemstellungen, wie etwa das schwierige Verhältnis von Sicht- und Unsichtbarkeiten oder das Zeigen und Nichtzeigen im Zusammenhang mit der affektiven Wirksamkeit von Bildern. Diese diskutiert sie anhand zahlreicher theoretischer Positionen und problematisiert die ambivalente Wirkung von Bildern im Wechselspiel von Emotion und Aufklärung.
Mit der Vorstellung von Fabio Bucciarellis eindrücklicher Fotostrecke aus dem italienischen Bergamo zeigt sie die Parallelen zur Fotoberichterstattung vorheriger Bedrohungslagen wie der Ebola-Epidemie, die jedoch eher als „Krise der Anderen“ wahrgenommen worden sei. Anknüpfend an die Beobachtung von Christian Mang unterstützt auch Karen Fromm, dass es neben grafischen Darstellungen des Virus nur wenig eindrückliche Bildmotive zur Visualisierung der Pandemie gebe, stattdessen eher symbolische Bildaussagen ohne eine „dokumentarische Annäherung an Leiden und Opfer“ (S. 76). Das Sichtbarmachen dieses Leidens stelle Fotograf:innen nicht nur vor große arbeitspraktische Hürden, sondern thematisiere vor allem arbeitsethische Fragen, die mit dem Eindringen in private, intime Bereiche zusammenhingen, in denen sich das persönliche Leid ereigne. Demgegenüber müsse stets das gesellschaftliche Informationsinteresse abgewogen werden. Als größte Herausforderung beschreibt Fromm die Leerstelle, die aus der Visualisierung des eigenen Leids entstehe, da ein Rückgriff auf klassische Bildnarrative des fremden Leids und der Opferikonografie nicht möglich sei. Schließlich fordert sie eine stärkere Reflexion über die Darstellung des Eigenen und des Fremden sowie über Stereotypisierungen in der Bildberichterstattung.
Wie eine Pandemie nicht in Fotografien, sondern in Grafiken visualisiert werden kann, thematisiert das anschließende Gespräch zwischen Michael Hauri und Julius Tröger von „ZEIT Online“ unter der Überschrift „Vom Nice-to-have zur Systemrelevanz – Datenvisualisierung in der Coronapandemie“ (S. 81-95). Da bei den meisten Leser:innen vermutlich wenig Vorwissen über Datenjournalismus im Allgemeinen vorhanden ist, erklärt Tröger zunächst allgemein, was Datenjournalismus überhaupt bedeute, wie die Arbeit mit Zahlen konkret aussehe und was eine gute Datenvisualisierung ausmache. „Können Daten eigentlich Emotionen auslösen?“ (S. 82) oder „Können Datenvisualisierungen helfen, den Journalismus glaubwürdiger zu machen?“ (S. 82), lauten weitere Fragen von Michael Hauri. Im Gespräch gibt Julius Tröger darüber hinaus Einblicke in die Arbeitsweise einer vernetzten Redaktion, in der Text, Bilder und Daten zusammenlaufen und gemeinsam gedacht werden. Er berichtet dabei auch, wie sich das Arbeiten in einer Datenredaktion in Zeiten von Lockdown und Homeoffice gestaltet, was für die Leser:innen interessante Einblicke bietet, über die sonst wenig gesprochen wird. Darüber hinaus betont er den steilen Aufstieg des Datenjournalismus vom Nebenressort zur systemrelevanten Komponente.
Felix Koltermann geht in seinem Aufsatz (S. 97-120) den Fragen nach, wie die bildredaktionelle Arbeit im Homeoffice während der Coronapandemie umgesetzt wurde, wie Bildredakteur:innen die Arbeit von zu Hause bewerten und welche Auswirkungen sie auf die Bildproduktion und -recherche hat. Nach einer Einführung erläutert Koltermann die Methode und das Sample seiner Untersuchung, ehe er zur Auswertung der Ergebnisse kommt und diese strukturiert wiedergibt. Die gestellten Fragen bilden dabei die Situation vor und die Umsetzung während der Pandemie sowie die Bewertung der Homeoffice-Erfahrung ab. Die Bildredakteur:innen bestätigen im Wesentlichen das, was aus anderen Studien zum Arbeiten im Homeoffice bereits bekannt ist, wie etwa veränderte Routinen, die Konformität von Arbeits- und Lebensort oder die gewandelte Kommunikation. Darüber hinaus gibt der Aufsatz Aufschlüsse darüber, wie verbreitet die Präsenzkultur in den Medienhäusern vor Ausbruch der Pandemie war und wie das erzwungene Umdenken die Arbeitsweisen verändert und sogar vorangebracht hat, da neue Wege für postpandemische Arbeitsmodelle mit mehr Flexibilität geebnet wurden.

Fotojournalistin Joyeeta Roy im Einsatz in Bangladesh (aus der Fotoserie: UN Women: Women of Bangladesh on the COVID-19 Frontline), 19. Mai 2020, Foto: UN Women/Fahad Abdullah Kaizer, Quelle: Flickr
Abgerundet wird der Sammelband durch Anna Stemmlers Essay „Komplexe Reflexionsräume“ über fotografisches Dokumentieren in der (Corona-)Krise (S. 121-142). Stemmler will anhand dokumentarfotografischer Serien aus Deutschland „mit ihren spezifischen Herangehensweisen indirekt fragen, wie Fotografie dazu beitragen kann, die Coronakrise zu verstehen“ (S. 122) – eine Krise, die in vielerlei Hinsicht medial vermittelt ist. Unter Titeln wie „Seltsame neue Welt“ (S. 122) oder „Rhapsodisches Erzählen“ (S. 125) stellt sie bildjournalistische Arbeiten zum Umgang mit der Pandemie vor, die alternative oder mitunter innovative Herangehensweisen aufzeigen. Ein Beispiel ist die Fotoserie von Ingmar Björn Nolting, der scheinbar selbsterklärende Motive ablichtet – solange der Kontext der Pandemie mitgedacht wird: Ein sporttreibender Mensch ist ein an sich unverfängliches Motiv, nicht jedoch, wenn sich die abgebildete Person gerade wieder zurück ins Leben kämpft nach einer schweren COVID-Erkrankung. Hier macht Anna Stemmler deutlich, dass Fotos eben nicht mehr als tausend Worte sagen, sondern häufig erst im Zusammenspiel mit der Bildunterschrift ihren Aussagegehalt entfalten können.
In der Analyse der Bildbeispiele geht es auch um dokumentarische Fotografie und ihre künstlerische Verarbeitung. Stemmler nennt diese Form der Überlagerung von dokumentarischer Fotografie und bewusster Gestaltung ein „erweitertes dokumentarisches Erzählen“ (S. 142) und regt sie auch für andere Kontexte an wie zum Beispiel für die Visualisierung der Klimakrise. Fachlich adäquat und berechtigt eingesetzt, ist der Essay durch die Verwendung der vielen Fachtermini für ein breiteres Zielpublikum zumindest herausfordernd. Es fehlen trotz der Fokussierung auf die fotografischen Produkte die Fotografien selbst, um die Ausführungen visuell abgleichen zu können. Die Bildbeschreibung „Vor einem Plattenbau lässt das durch Rollatoren fragil wirkende Rentnerpaar seine Nasen wagemutig maskenfrei, während der junge Mann neben ihnen visuell hinter seiner Maske in Deckung geht, auf der ein Totenschädel mit Monstergebiss zu sehen ist, was als apotropäische, als Unheil abwendende Geste gelesen werden kann“ (S. 129) lässt die Leser:innen die Fotografie dazu schmerzlich vermissen.
Insgesamt vermittelt der Sammelband „Corona und die journalistische Bildkommunikation“ einen breiten Eindruck des Bildjournalismus während und hypothetisch auch nach der Pandemie. Er versteht sich als Momentaufnahme einer längst noch nicht abgeschlossenen Entwicklung, in der die Coronapandemie nur eines von vielen Zahnrädern ist – wenn auch ein großes. Die Beiträge bieten interessante Einblicke und setzen sich auf verschiedenen Ebenen mit dem Komplex auseinander, werfen aber ebenso viele Fragen für zukünftige Forschungen auf. Besonders hervorzuheben ist neben der abwechslungsreichen Tiefe der fachlichen Auseinandersetzung auch die Interdisziplinarität der Beiträge, die von arbeitsökonomischer Analyse bis hin zu kunstwissenschaftlicher Auseinandersetzung reicht. Was den positiven Gesamteindruck allerdings trübt, ist die eher dürftige Bebilderung, von der es an der einen oder anderen Stelle sehr viel mehr hätte sein dürfen, um auch auf der visuellen Ebene einen Einblick zu geben und die Diskussion eben nicht nur über Sprache zu führen.
Zitation
Marian Kulig, Rezension: „Corona und die journalistische Bildkommunikation: Praktiken und Diskurse des Visuellen” herausgegeben von Felix Koltermann, in: Visual History, 01.03.2022, https://visual-history.de/2022/03/01/kulig-rezension-corona-und-die-journalistische-bildkommunikation/
Nutzungsbedingungen für diesen Artikel
Copyright (c) 2020 Clio-online e.V. und Autor*in, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online Projekts „Visual-History“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber*in vorliegt.
Bitte kontaktieren Sie: <bartlitz@zzf-potsdam.de>

